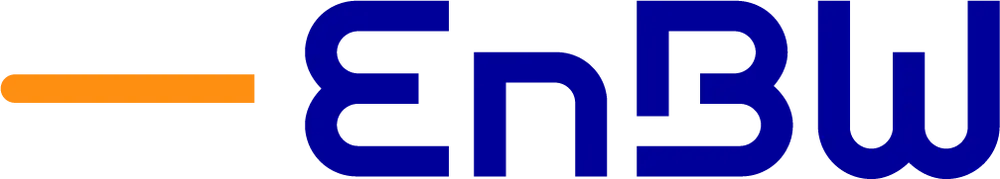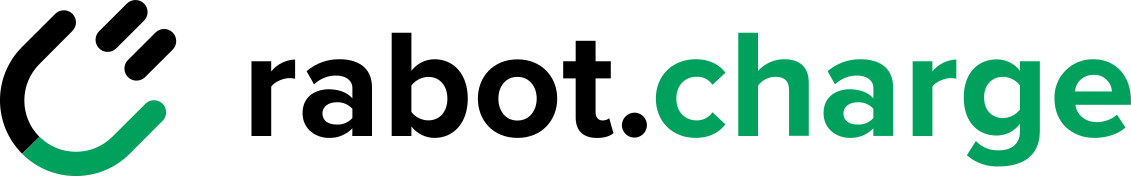Inhaltsverzeichnis:
Marktkonzentration hält Strompreise in Österreich hoch
Mehr als 20 Jahre nach der Öffnung des österreichischen Strommarkts dominieren weiterhin die Landesversorger das Geschehen. Laut derStandard.de bleibt der Wettbewerb aus, was von vielen als Hauptursache für die hohen Strompreise gesehen wird. Die Energieversorger sind eng miteinander verflochten, was als Reaktion auf die Marktöffnung interpretiert wird.
Ein dichtes Geflecht aus staatsnahen Firmen hält die Preise in Österreich weiter hoch. Haushalte könnten jedes Jahr hunderte Euro sparen, wenn der Strom günstiger wäre. Auch Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, hätten es leichter, mit der Konkurrenz mitzuhalten.
"So schön könnte die Welt sein – wäre der Strom nur billiger."
Infobox: In Österreich verhindern enge Verflechtungen der Energieversorger einen echten Wettbewerb, was die Strompreise für Haushalte und Unternehmen hoch hält. (Quelle: derStandard.de)
Grüne Jugend fordert Enteignung großer Energie- und Stahlkonzerne
Der Co-Vorsitzende der Grünen Jugend, Jakob Blasel, fordert laut Ntv die Enteignung der Energiekonzerne RWE und Leag sowie des größten deutschen Stahlherstellers Thyssenkrupp. Blasel bezeichnet diese Unternehmen als die "drei klimaschädlichsten Konzerne" und schlägt vor, sie zu vergesellschaften. Er argumentiert, dass Unternehmen in der Hand der Verbraucherinnen und Arbeiter nachhaltiger wirtschaften würden, da niemand für einen Betrieb arbeiten wolle, der die eigene Zukunft zerstört.
Blasel räumt ein, dass sein Vorschlag außerhalb des aktuellen politischen Diskurses liegt, betont jedoch, dass die derzeitigen Maßnahmen nicht ausreichen, um den Klimawandel zu bekämpfen. Er kritisiert, dass der Kampf gegen den Klimawandel von "fossilen Lobbyisten" untergraben werde. Zudem fordert er, dass Beschäftigte in fossilen Unternehmen eine Perspektive in anderen, nicht-fossilen Branchen erhalten und ohne Abstriche übernommen werden.
"Radikal ist das Ausmaß der Klimakrise und der globalen Ungerechtigkeit." (Jakob Blasel, Grüne Jugend)
Infobox: Die Grüne Jugend fordert die Enteignung von RWE, Leag und Thyssenkrupp, um den Klimaschutz voranzutreiben und nachhaltiges Wirtschaften zu fördern. (Quelle: Ntv)
Balkonkraftwerke: Solarstrom vom eigenen Balkon wird immer beliebter
Solaranlagen am Balkon, sogenannte Balkonkraftwerke, erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Wie Merkur berichtet, hat Energie-Pionier Fritz Lietsch aus Wiesham vor drei Jahren eine solche Anlage installiert. Mit drei Solarpanelen, die rund 700 Euro gekostet haben, produziert er jährlich 800 kWh Strom. Bei einem angenommenen Preis von 30 Cent pro Kilowattstunde spart er damit 240 Euro pro Jahr. Die Anlage amortisiert sich somit bereits nach zwei Jahren.
Balkonkraftwerke funktionieren wie kleine Photovoltaikanlagen: Sonnenlicht wird in Strom umgewandelt, der direkt ins Hausnetz eingespeist werden kann. Die Montage ist laut Lietsch für handwerklich Geschickte einfach, es gibt aber auch flexible Module und Befestigungs-Sets. In Deutschland sind rund eine Million Balkonkraftwerke in Betrieb, davon über 150.000 in Bayern (Stand 30. Juni). In den letzten sechs Monaten kamen 33.000 Anlagen hinzu. Bayern hat die zweitmeisten Anlagen in Deutschland, nur Nordrhein-Westfalen hat mehr.
| Anzahl Balkonkraftwerke in Deutschland | ca. 1.000.000 |
|---|---|
| Anzahl in Bayern (gemeldet) | über 150.000 |
| Neuzugänge in 6 Monaten | 33.000 |
| Kosten (3 Module, 2022) | 700 Euro |
| Kosten (2 Module, aktuell) | ab 300 Euro |
| Jährliche Stromproduktion (Beispiel Lietsch) | 800 kWh |
| Jährliche Ersparnis (bei 30 Cent/kWh) | 240 Euro |
| Amortisationszeit | 2 Jahre |
- Viele Städte und Gemeinden fördern die Anschaffung mit Zuschüssen oder Sammelbestellungen.
- Die Stadt München bezuschusst bis zu 50 Prozent der Kosten, maximal 320 Euro.
- Auch Mieter dürfen Balkonkraftwerke installieren, Vermieter dürfen den Aufbau nicht ohne triftigen Grund ablehnen.
Infobox: Balkonkraftwerke sind eine kostengünstige Möglichkeit, Stromkosten zu senken und die Energiewende voranzutreiben. In Bayern sind über 150.000 Anlagen gemeldet, die Amortisation kann bereits nach zwei Jahren erfolgen. (Quelle: Merkur)
KI und Energie: Rechenzentren treiben Strombedarf in neue Dimensionen
Der Energieverbrauch von Künstlicher Intelligenz (KI) und Rechenzentren nimmt rasant zu. Laut WELT erwartet die Internationale Energie-Agentur, dass sich der weltweite Strombedarf von Rechenzentren in den nächsten fünf Jahren mehr als verdoppelt. Bis 2030 könnten Rechenzentren so viel Strom verbrauchen wie ganz Japan heute. In den USA werden Rechenzentren voraussichtlich fast die Hälfte des Anstiegs der Stromnachfrage ausmachen, in Japan mehr als die Hälfte.
Die Universität Cambridge schätzt, dass sich der Energiebedarf der Big-Tech-Branche durch KI in den nächsten 15 Jahren mindestens verfünffachen wird. Unternehmen wie Meta haben bereits 20-jährige Energieverträge abgeschlossen, Google setzt auf kleinere Atomkraftwerke. Im Nachhaltigkeitsbericht von Google wird ein Anstieg der Treibhausgas-Emissionen für 2023 um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr und um 48 Prozent gegenüber 2019 ausgewiesen. Auch bei Microsoft stiegen die Emissionen im Vergleich zu 2020 um mehr als 23 Prozent.
| Prognose Strombedarf Rechenzentren (bis 2030) | so viel wie ganz Japan heute |
|---|---|
| Stromnachfrage-Anstieg USA (Rechenzentren) | fast 50 % des Anstiegs |
| Stromnachfrage-Anstieg Japan (Rechenzentren) | mehr als 50 % des Anstiegs |
| Big-Tech-Energiebedarf (Prognose 15 Jahre) | mindestens 5-fach höher |
| Google Emissionen 2023 vs. 2019 | +48 % |
| Google Emissionen 2023 vs. Vorjahr | +13 % |
| Microsoft Emissionen 2023 vs. 2020 | +23 % |
Studien zeigen, dass der Energieverbrauch von KI-Anwendungen stark variiert – je nach Modellgröße, Rechenaufwand und Thema. Anfragen mit komplexem "Reasoning" können sechsmal höhere Emissionen verursachen als einfache Wissensabfragen. Besonders genaue Modelle haben eine schlechtere Klimabilanz.
- Verbraucher haben kaum Transparenz über den Energieverbrauch ihrer KI-Anfragen.
- Experten fordern mehr Transparenz und globale Standards zur Regulierung der ökologischen Kosten von KI.
- Der Energiemix ist entscheidend: Für Europa bedeutet das, günstige und saubere Energie für Rechenzentren bereitzustellen.
„Der weltweite Strombedarf von Rechenzentren wird sich in den nächsten fünf Jahren mehr als verdoppeln und bis 2030 so viel Strom verbrauchen wie ganz Japan heute.“ (Fatih Birol, IEA)
Infobox: Der Energiebedarf von KI und Rechenzentren wächst rasant. Prognosen sehen eine Verfünffachung des Energiebedarfs der Big-Tech-Branche in 15 Jahren. Die Emissionen großer IT-Konzerne steigen deutlich. (Quelle: WELT)
Quellen:
- Ein paar Riesen beherrschen Österreichs Strommarkt. Wie viel billiger wird Energie, wenn wir das ändern?
- Energie und Stahlindustrie: Grüne-Jugend-Chef will drei Großunternehmen enteignen
- Mein Strom vom Balkon: Energie-Pionier erklärt, worauf es bei Solaranlagen ankommt
- Energieverbrauch KI: Wenn ChatGPT und Co. eigene Atomkraftwerke brauchen
- Energie Cottbus kassiert mehr als 120.000 Euro aus Nachwuchsförderung
- Energie Cottbus: FCE international – wie Nikolas (11) aus Athen zum Fan wurde