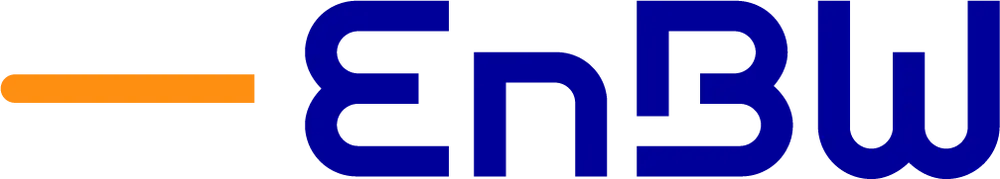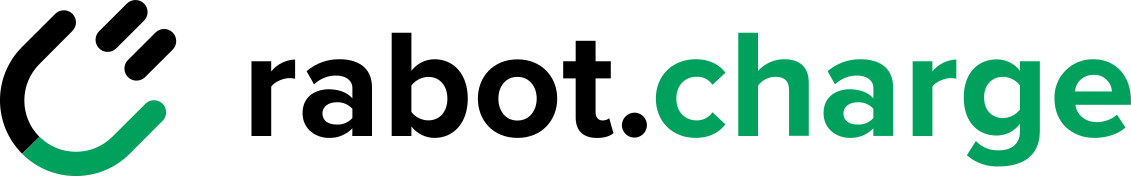Inhaltsverzeichnis:
Erdwärme in Brandenburg: Untersuchungen zur CO2-freien Wärmeversorgung
Das Wirtschaftsministerium Brandenburg lässt ab Juli untersuchen, ob und wo in der Niederlausitz Erdwärme genutzt werden kann. Wirtschaftsminister Daniel Keller (SPD) betont, dass das geplante Untersuchungsprogramm einen wichtigen Schritt in Richtung einer CO2-freien Wärmeversorgung und damit zur Erreichung der Ziele der Wärmewende darstellt. Die Ergebnisse der Untersuchungen sind für die Kommunen entscheidend, um künftig mit Erdwärme planen zu können.
Nach Angaben des Ministeriums wird bereits in 1.000 Metern Tiefe eine Temperatur von rund 40 Grad Celsius erreicht. Mit jedem weiteren 100 Meter Tiefe steigt die Temperatur um jeweils 3 Grad Celsius. Das Ministerium spricht von einem „unerschöpflichen Wärmereservoir“, das in der Niederlausitz genutzt werden soll. Das Projekt wird mit drei Millionen Euro bezuschusst. Der Untergrund zwischen Cottbus und Guben wird auf mögliche wasserführende, heiße Schichten getestet. Die vorbereitende Erkundung beginnt noch im Juli und erstreckt sich entlang der Strecke vom nordöstlichen Cottbus über Peitz, Tauern, Bärenklau, Schenkendöbern, Guben bis südlich nach Groß Gastrose. Im Herbst 2025 sollen die Anwohnerinnen und Anwohner auf öffentlichen Infoveranstaltungen über das Projekt informiert werden, so Birgit Futterer, Direktorin des Geologischen Dienstes beim LBGR.
„Mit dem geplanten Untersuchungsprogramm kommen wir einer CO2-freien Wärmeversorgung und somit den Zielen der Wärmewende einen Schritt näher“, sagte Wirtschaftsminister Daniel Keller (SPD).
- Untersuchungsstart: Juli 2025
- Fördersumme: 3 Millionen Euro
- Temperatur in 1.000 m Tiefe: ca. 40 °C
- Temperaturzuwachs pro 100 m: 3 °C
- Öffentliche Infoveranstaltungen: Herbst 2025
Infobox: Brandenburg investiert drei Millionen Euro in die Erkundung von Erdwärme in der Niederlausitz. Bereits in 1.000 Metern Tiefe werden rund 40 Grad Celsius gemessen, was großes Potenzial für eine CO2-freie Wärmeversorgung bietet. (Quelle: DIE ZEIT)
Japan setzt 14 Jahre nach Fukushima wieder auf Atomkraft
Japan treibt den Ausbau der Kernenergie voran. Nach Angaben der Berliner Zeitung wurden bereits 14 der nach Fukushima stillgelegten Reaktoren wieder hochgefahren. Die Regierung plant zudem, neue Reaktoren auf bestehenden Standorten zu errichten. Bis 2040 soll der Anteil der Kernenergie an der Stromversorgung auf 20 Prozent steigen. Bisher lag der Atomanteil am japanischen Strommix bei lediglich 8,5 Prozent, nachdem er seit der Katastrophe von Fukushima 2011 drastisch gesunken war.
Die Kehrtwende wird unter anderem durch stark gestiegene Gaspreise infolge des Ukrainekriegs und den wachsenden Strombedarf durch Rechenzentren für Künstliche Intelligenz begründet. Neben der Reaktivierung älterer Meiler will Japan auch neue Reaktortypen wie kleine modulare Reaktoren (SMRs) und Hochtemperatur-Gasreaktoren entwickeln. Erste Inbetriebnahmen werden in den 2030er-Jahren erwartet. Unternehmen wie Hitachi, IHI und Chubu Electric engagieren sich bereits in internationalen Pilotprojekten, unter anderem in den USA und Kanada.
Es gibt jedoch Widerstand gegen die Inbetriebnahme von Atomreaktoren, insbesondere in Regionen wie rund um das AKW Kashiwazaki-Kariwa, wo lokale Behörden bislang die Wiederinbetriebnahme verweigern. Auch die japanische Anwaltskammer kritisiert den Kurs als riskant und warnt vor einer Verdrängung der Folgen der Fukushima-Katastrophe. Am 11. März 2011 kamen durch das Erdbeben der Stärke 9,0 und den darauffolgenden Tsunami 18.000 Menschen ums Leben. Die Katastrophe führte zur Kernschmelze in drei Reaktoren des Atomkraftwerks Fukushima.
- Reaktivierte Reaktoren: 14
- Geplanter Atomstrom-Anteil 2040: 20 %
- Aktueller Atomstrom-Anteil: 8,5 %
- Erwartete Inbetriebnahme neuer Reaktoren: 2030er-Jahre
- Opfer der Katastrophe 2011: 18.000 Menschen
Infobox: Japan will bis 2040 den Anteil der Kernenergie an der Stromversorgung auf 20 Prozent erhöhen. 14 Reaktoren wurden bereits wieder in Betrieb genommen, neue Reaktortypen sind in Planung. (Quelle: Berliner Zeitung)
Gezielte Angriffe auf Energie- und Gasobjekte in der Region Sumy
Die russische Armee greift gezielt Energie- und Gasanlagen in der Region Sumy an. Laut Oleh Hryhorow, Leiter der Militärverwaltung von Sumy, sind in der Region fast 20.000 Verbraucher in 147 Siedlungen weiterhin ohne Strom. Einige dieser Siedlungen sind unbewohnt, da alle Bewohner evakuiert wurden. Durch den Beschuss am vergangenen Tag blieben mehr als ein halbes Tausend Verbraucher ohne Strom, doch am Morgen konnten Energiearbeiter die Stromversorgung wiederherstellen.
Auch Gasanlagen wurden beschädigt. Im Laufe des Tages blieben sieben weitere Kunden ohne Gas. Insgesamt sind mehr als 13.000 Verbraucher in der Region ohne Gasversorgung – eine kumulierte Zahl für die gesamte Dauer des umfassenden Krieges. Die Behörden arbeiten daran, die Strom- und Gasversorgung wiederherzustellen, sobald es die Sicherheitslage erlaubt. Am 7. Juli wurden in der Gemeinde Chotyn die Leichen von zwei Männern gefunden, die bei einem Angriff ums Leben kamen.
| Betroffene Verbraucher ohne Strom | ca. 20.000 |
|---|---|
| Betroffene Siedlungen | 147 |
| Verbraucher ohne Gasversorgung (gesamt) | über 13.000 |
| Neue Kunden ohne Gas (letzter Tag) | 7 |
Infobox: In der Region Sumy sind infolge gezielter Angriffe fast 20.000 Verbraucher ohne Strom und über 13.000 ohne Gasversorgung. Die Behörden bemühen sich um eine Wiederherstellung der Versorgung. (Quelle: ukrinform.de)
Ökostrom-Boom in Unterfranken: Netzbetreiber müssen Anlagen drosseln
In Unterfranken müssen immer mehr Ökostrom-Anlagen gedrosselt werden, um ein Kollabieren des Netzes zu verhindern. Dadurch bleibt viel Energie ungenutzt. Besonders in diesem Jahr ist der Anteil der abgeregelten Energie offenbar hoch. Bei der ÜZ gingen im April 2.600 Megawattstunden (MWh) an Ökostrom verloren. Mit dieser Menge hätte man 750 Durchschnittshaushalte ein Jahr lang versorgen können.
Aktuell sind in Deutschland Solarparks mit einer Leistung von 27,3 Gigawatt installiert (Stand September 2024), die etwa 40.000 Hektar Fläche beanspruchen. Das entspricht weniger als 0,2 Prozent der Gesamtfläche Deutschlands. Die PV-Anlagen erzeugen weniger als 14 Prozent des benötigten Stroms in Deutschland. Im Landkreis Würzburg stehen 71 Windkraftanlagen, von denen eine im Jahr etwa 5.000 MWh Strom liefert.
| Verlorene Ökostrommenge (April, ÜZ) | 2.600 MWh |
|---|---|
| Versorgbare Haushalte (mit 2.600 MWh) | 750 |
| Installierte Solarpark-Leistung (Deutschland, 09/2024) | 27,3 GW |
| Beanspruchte Fläche Solarparks | 40.000 ha |
| Flächenanteil Solarparks an Deutschland | < 0,2 % |
| PV-Anteil am Strombedarf (Deutschland) | < 14 % |
| Windkraftanlagen im Landkreis Würzburg | 71 |
| Jahresproduktion einer Windkraftanlage | 5.000 MWh |
Infobox: Im April gingen bei der ÜZ 2.600 MWh Ökostrom verloren – genug, um 750 Haushalte ein Jahr zu versorgen. In Deutschland sind 27,3 GW Solarleistung installiert, was weniger als 0,2 Prozent der Landesfläche beansprucht. (Quelle: Mainpost)
Quellen:
- Energie: Schwankende Strompreise – Unternehmen sparen mit neuen Strategien bis zu 30 Prozent
- Energie: Brandenburg prüft Erdwärme in der Niederlausitz
- Energie: Darum setzt Japan 14 Jahre nach Fukushima wieder auf Atomkraft
- Russische Armee greift gezielt Energie- und Gasobjekte in Region Sumy an
- Boom bei Öko-Strom zwingt Netzbetreiber zum Abschalten: Wieso in der Region viel Energie ungenutzt bleibt
- Energie Cottbus: Streit um Wechsel zu Union Berlin – Debüt von Linus Güther